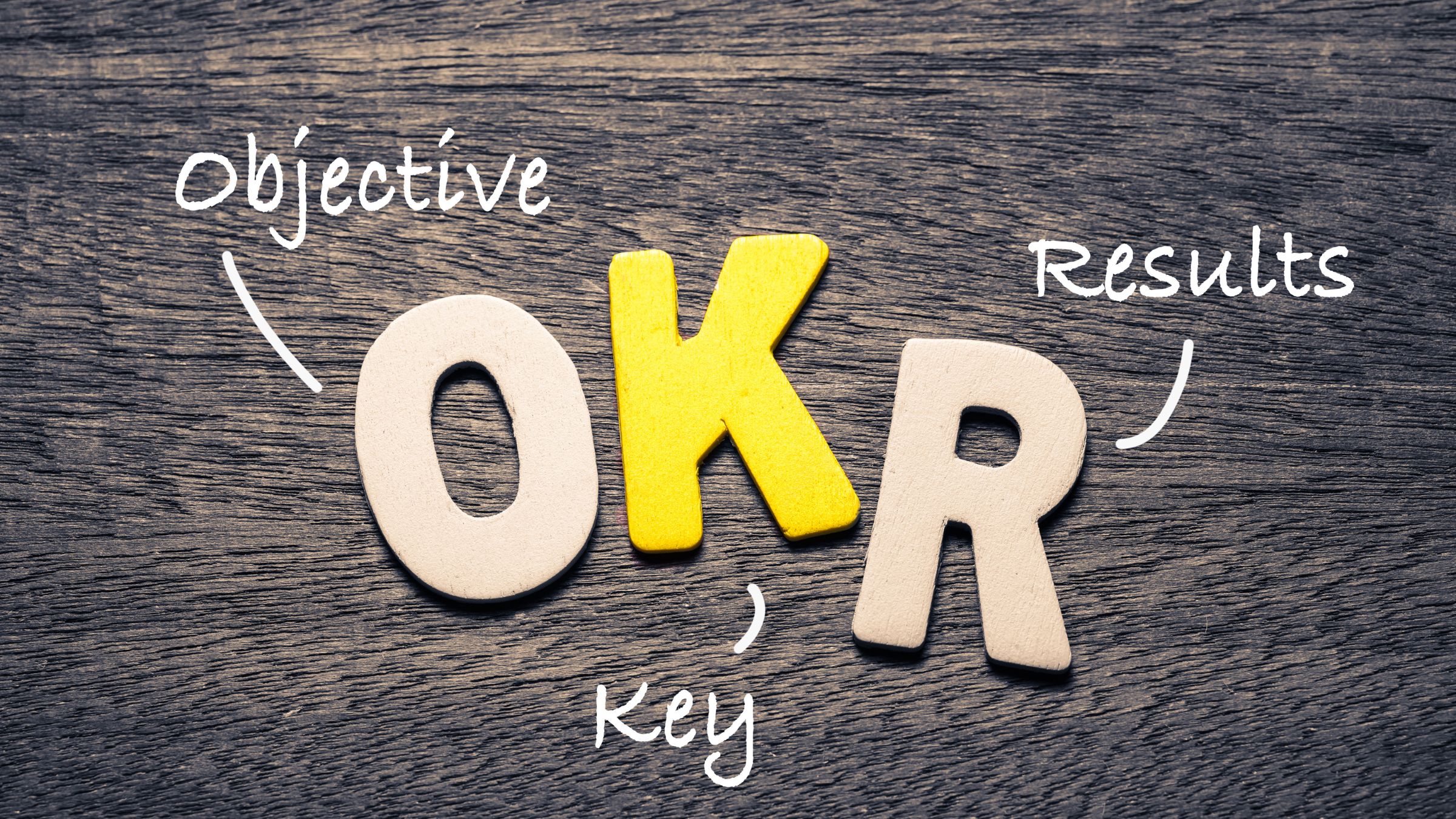
Komplexität, Veränderungsdruck und knappe Ressourcen prägen heute den Projektalltag. Gefragt sind klare Zielbilder, die Orientierung geben, auf verändernde Rahmenbedingungen reagieren können und dadurch Wirkung entfalten. Genau hier setzt das Framework OKR an: Mit Objectives and Key Results gelingt es, strategische Ziele in Teilschritten verständlich zu machen und Fortschritt so kontinuierlich und messbar abzubilden – im Sinne des Projekterfolgs und der Teamarbeit.
OKR steht für „Objectives and Key Results“. Es handelt sich um eine Methode der Zieldefinition und -verfolgung, bei der jedes Ziel („Objective“) durch mehrere messbare Schlüsselergebnisse („Key Results“) konkretisiert wird. Dabei bilden Objective und Key Results stets eine Einheit. Während das Objective ein motivierendes Zielbild formuliert, beschreiben die Key Results, wie sich Fortschritt auf dem Weg dorthin sichtbar machen lässt.
Die Methode geht über das Generieren eines Outputs hinaus und fokussiert sich auf die Auswirkung der Maßnahmen (Outcome). OKR arbeitet mit der Wirkung von Ergebnissen und macht Veränderung somit greifbarer. Es geht nicht darum, Aufgaben abzuhaken, sondern echte Veränderung herbeizuführen.
OKR hilft dort, wo Projekte strategische Wirkung entfalten sollen und Komplexität reduziert werden muss. Besonders bei Transformationsprojekten, agilen Umgebungen oder organisationsweiten Vorhaben spielt OKR seine Stärken aus und auch in der öffentlichen Verwaltung punktet OKR mit seinen agilen Mechanismen und kurzfristigen Zyklus.
Gerade in dynamischen Projekten mit vielen Stakeholdern stellt OKR sicher, dass alle Beteiligten an denselben Ergebnissen arbeiten, ohne dass die Zielrichtung durch operative Hektik verwässert wird.
Im Vergleich zu traditionellen Methoden wie Management by Objectives (MbO) oder SMART-Zielen bringt OKR einige entscheidende Unterschiede mit sich:
Klassische Zielsysteme arbeiten oft mit Jahreszielen, während OKR auf kurze Zyklen von etwa drei Monaten setzt. Ziele werden im klassischen Modell meist top-down vorgegeben, bei OKR hingegen erfolgt die Entwicklung partizipativ, also unter aktiver Einbindung der Teams. Zudem orientieren sich klassische Zielsysteme häufig an Outputs, also an abgeschlossenen Aufgaben oder erzeugten Leistungen. OKR dagegen stellt den Outcome, also die tatsächliche Wirkung und Veränderung, in den Mittelpunkt.
Auch die Messbarkeit unterscheidet sich: Klassische Ziele sind häufig nicht konkret überprüfbar, während OKR explizit darauf ausgerichtet ist, Fortschritte regelmäßig zu messen. Und schließlich zeigt sich ein deutlicher Unterschied im Vorgehen: Während klassische Systeme mit statischer Planung arbeiten, ist OKR iterativ angelegt, mit festen Überprüfungs- und Anpassungsphasen nach jedem Zyklus.
Projekte bewegen sich heute in einem Spannungsfeld aus Ungewissheit, Geschwindigkeit und Anspruch an Zusammenarbeit. Klassische Steuerung stößt dabei oft an Grenzen: Das Ziel ist diffus, Prioritäten wechseln, das Team verliert Orientierung.
OKR begegnet diesen Herausforderungen, indem die Methode:
Dazu kommt: OKR funktioniert teamübergreifend. Das macht die Methode anschlussfähig für Projektarbeit in der Matrixorganisation oder bei bereichsübergreifenden Vorhaben.
Wichtig ist eine klare Abgrenzung: OKR ist kein Aufgabenmanagement-Tool. Es ersetzt weder ein Kanban-Board noch ein Projektstrukturplan. OKR wirkt auf einer anderen Ebene – nämlich dort, wo strategischer Fokus, Wirkungsmessung und Motivation entstehen. Richtig eingesetzt, ergänzt OKR vorhandene PM-Methoden wie klassische Planung oder agile Frameworks (z. B. Scrum) ideal.
OKR schafft Verbindlichkeit durch Verständlichkeit. Wer im Projekt Verantwortung trägt, ob als Leitung, PMO oder Teammitglied, findet in OKR ein Werkzeug, um Ziele klar zu machen, Wirkung zu messen und das Team fokussiert zu halten. Gerade in bewegten Zeiten eine lohnende Investition.
Keine Kommentare
Elisabeth Schlachter ist Wirtschaftspädagogin und Expertin für Strategieentwicklung. Als Geschäftsführerin der Schlachtplan GmbH unterstützt sie Unternehmen bei der Einführung neuer Arbeitsmethoden und der erfolgreichen Umsetzung strategischer Ziele.
info@schlachtplan.de
Kommentare