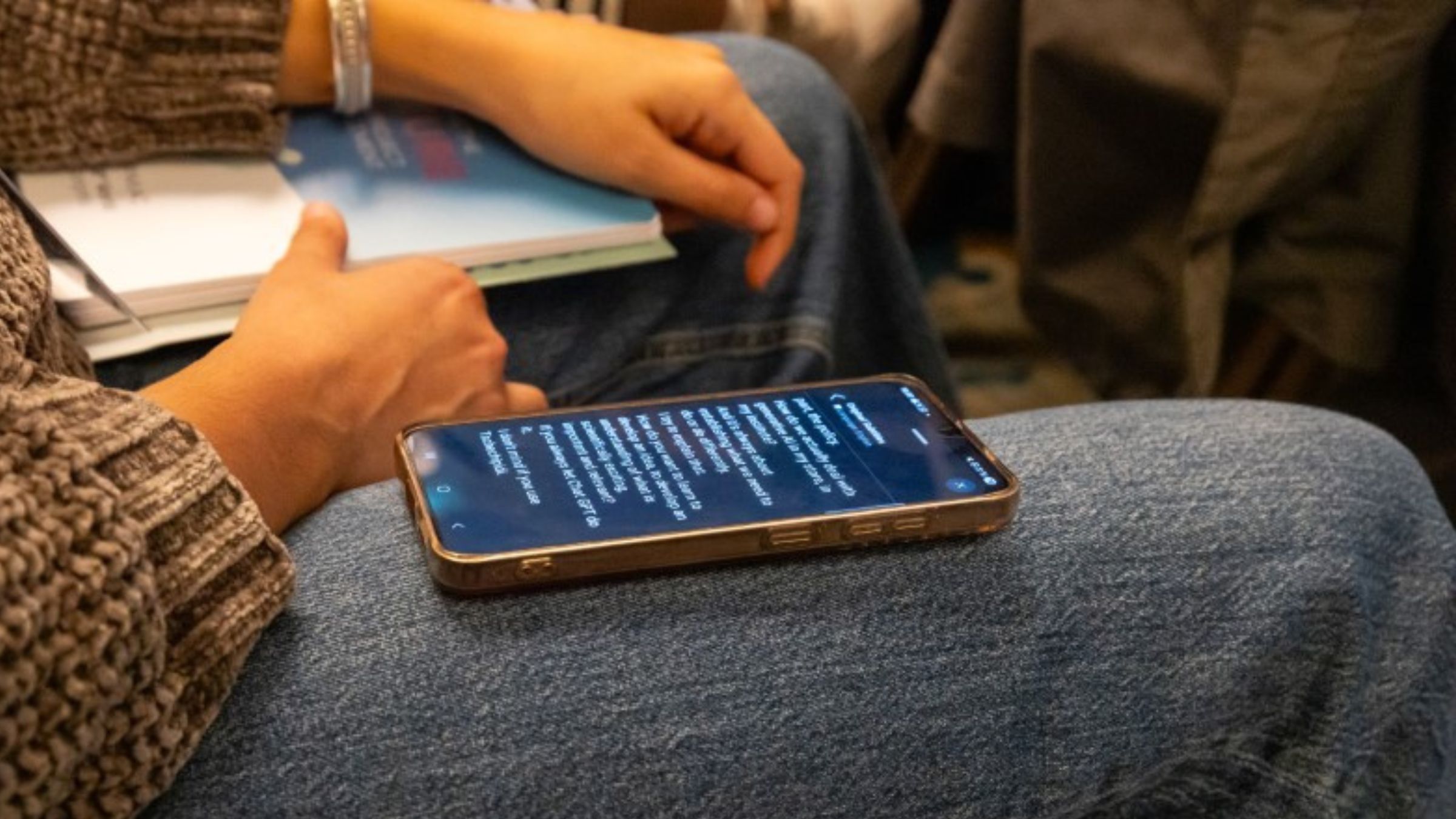
Die Digitalisierung verändert das Projektmanagement bereits seit Jahrzehnten grundlegend. Die Nutzungsmöglichkeiten von KI-gestützte Tools zur automatisierten Meetingaufzeichnung, Transkription und Analyse halten Einzug in den Arbeitsalltag. Sie gelten als einfach zu bedienen und versprechen Effizienz sowie lückenlose Dokumentation. Doch hinter diesem scheinbar unkomplizierten Fortschritt verbergen sich erhebliche Risiken, insbesondere für das Vertrauen im Team und die rechtliche Sicherheit.
Automatisierte Protokolle, Aufgabenlisten und Entscheidungsdokumentationen sind im Projektalltag eine Entlastung. Sie schaffen Struktur und Transparenz. Doch sobald die Aufzeichnung läuft, verändert sich das Kommunikationsverhalten. Spontane Ideen, kritische Anmerkungen und informeller Austausch werden seltener geäußert. Die Sorge, dass jedes Wort gespeichert und später gegen einen verwendet werden könnte, führt zu Vorsicht und Selbstzensur. Vertrauen, das Fundament jeder erfolgreichen Zusammenarbeit, wird geschwächt.
Die DSGVO stellt klare Anforderungen. Jede Aufzeichnung eines Meetings ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten. Eine freiwillige, informierte und dokumentierte Einwilligung aller Teilnehmenden ist zwingend notwendig. Besonders kritisch ist der Einsatz von KI-Systemen zur Analyse von Redeanteilen, Aufgabenübernahmen oder Stimmungen. Diese können als verdeckte Leistungserfassung gewertet werden und damit gegen Datenschutz- und Arbeitsrecht verstoßen.
Auch strafrechtlich kann es heikel werden: Nach § 201 StGB ist die Aufnahme nicht öffentlich gesprochener Worte ohne Zustimmung strafbar. Selbst das temporäre Zwischenspeichern zur Transkription kann darunterfallen. Unternehmen müssen sicherstellen, dass alle Teilnehmenden vorab umfassend informiert sind und der Aufzeichnung nachweislich zustimmen. Eine bloße Ankündigung im Meeting genügt nicht. Die Zustimmung muss dokumentiert und jederzeit widerrufbar sein.
Besonders problematisch wird es bei vermeintlich vertraulichen Gesprächen. Spricht ein Teammitglied im persönlichen Austausch mit der Projektleitung offen über Leistungsdruck oder private Probleme, kann eine automatische Aufzeichnung gravierende Folgen haben. Wird das Transkript ungefiltert im Projektordner abgelegt, entsteht ein massiver Vertrauensbruch. Informationen, die im geschützten Rahmen bleiben sollten, sind plötzlich öffentlich im Team. Die Folge: Weniger Offenheit, mehr Zurückhaltung – und ein langfristiger Schaden für die Teamkultur.
Gute Meetings basieren auf klarer Zielsetzung, sorgfältiger Vorbereitung und passender Teilnehmendenauswahl. Genau hier kann KI unterstützen – etwa bei der Strukturierung von Unterlagen oder der Zusammenfassung relevanter Informationen. Entscheidend bleibt jedoch: Nicht jedes Meeting und nicht jede Passage muss aufgezeichnet werden. Der reflexartige Einsatz von KI, nur weil es technisch möglich ist, führt oft zu aufwendigen Nacharbeiten und unklaren Ergebnissen (sog. Workslops). Die Effizienz geht verloren, wenn KI-generierte Artefakte aufwendig geprüft und angepasst werden müssen, bevor sie in den Arbeitsprozess integriert werden können.
Eine einfache Frage zeigt, wie weit das eigene Projektteam ist: Wie viele Meetings haben eine Agenda mit klarem Ziel pro Punkt? Wenn es hier schon hapert, ersetzt KI keine fehlende methodische Disziplin. Im Gegenteil: Die Analyse durch KI kann Aufgaben zutage fördern, die weder zum Projektauftrag noch zur Zuständigkeit passen. Wer ohne methodisches Fundament arbeitet, riskiert eine Scheingenauigkeit, die mehr schadet als nützt.
KI kann das Projektmanagement effizienter machen. Aber sie darf nicht zur Belastung für Vertrauen und Rechtssicherheit werden. Wer Meetingaufzeichnungen einführt, braucht klare Regeln, Einwilligungen und eine bewusste Entscheidung darüber, was dokumentiert wird – und was besser nicht. Die verdeckte automatisierte Leistungserfassung ist keine Option. Sie untergräbt nicht nur das Miteinander im Team, sondern auch die rechtliche Integrität des Unternehmens.
KI ist ein Werkzeug – kein Ersatz für Führung, Kommunikation und methodisches Denken. Ihre Einführung sollte immer mit einer Datenschutz-Folgenabschätzung und verbindlichen Nutzungsrichtlinien einhergehen. Nicht jedes Meeting muss effizient sein. Manchmal braucht es Raum für das Menschliche: für Spontaneität, Kreativität und auch für Fehler. Nur so bleibt das Vertrauen erhalten, das jedes Projekt zum Erfolg trägt.
Keine Kommentare
Bernhard Konrad Schwab vereint langjährige Beratungs- und Projektmanagement-Erfahrung mit Professionalität, Leidenschaft und Humor. Komplexe Themen vermittelt er lebendig, anschaulich und praxisnah. Als gefragter Speaker begeistert er mit Klarheit und greifbaren Impulsen. Sein Fokus liegt auf Prozessoptimierung, Automatisierung im Projektmanagement und pragmatischer Unterstützung von Unternehmen. Ehrenamtlich engagiert er sich als Mentor bei GPM und PMI sowie in der Regionalleitung der GPM Stuttgart.
b.schwab@gpm-ipma.de
Kommentare